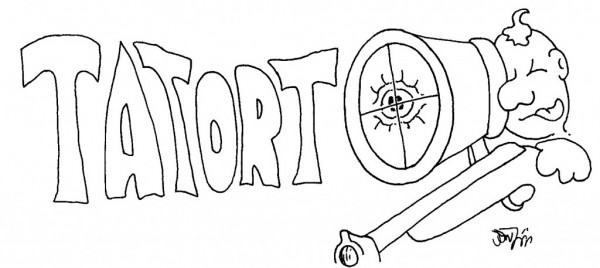„Tatort: Im Schmerz geboren“ oder Diamant in den Ketten des Serienformats
„Tatort: Im Schmerz geboren“ (2014) von Florian Schwarz
Ich beklagte in der Vergangenheit ja schon den traurigen Zustand der deutschen Krimilandschaft im Allgemeinen und ihres Flaggschiffs des „Tatort“ im Besonderen. Entsprechend selten verfolge ich die Reihe inzwischen und ließ so auch den dritten Ulrich-Tukur-„Tatort“ aus – nur, um dann am nächsten Tag alle Welt ausflippen zu hören, was für ein besonderer und künstlerischer Film es gewesen wäre.
Nun gut, dank Nachtwiederholung konnte ich ihn nachholen. – Und kann den Lobeshymnen gar nicht genug beipflichten!
Guter Krimi…
Schon der reine, zugrunde liegende Krimi war von außerordentlicher Qualität: Der von Ulrich Matthes gespielte Ex-Polizist und Gangster Richard Harloff war eine große, strahlende Schurkengestalt, wie sie das deutsche Fernsehen selten bis nie zustande bringt. Seine Motive und sein Plan waren zwar wahnwitzig und überzogen, aber im Rahmen des Möglichen und vor allem filmisch Plausiblen. Zudem verband ihn eine Jugendfreundschaft mit Ulrich Tukurs Kommissar Murot, was den Film emotional unterstrich und zuletzt gestattete man ihm, seine Verbrechen mit einer Eleganz zu begehen, die dem Zuschauer Respekt für ihn abnötigte. – Die Szene, in der er den Laserpunkt eines Scharfschützen pantomimisch mit der Hand auf sein Opfer „wirft“ dürfte zu den herausragendsten Mordszenen der Filmgeschichte gehören.
Somit kam man, obwohl sein Schurke keine moralisch ambivalente, sondern vollkommen verwerfliche Figur war, von dem üblichen Schwarzweiß-Schema ab, mit dem man gern die Welt einfach hält: Ja, Harloff ist absolut böse und ja, Murot ist gut. Aber die Bühne beherrscht der Schurke und er ist es, der uns ins Staunen versetzt. Er hat nicht unsere Sympathie, aber unsere Bewunderung.
… plus künstlerischer Anspruch…
Schon dadurch wäre es ein überdurchschnittlicher „Tatort“ geworden, doch was „Im Schmerz geboren“ in eine eigene Klasse erhob waren die künstlerischen Verfremdungen: Es beginnt mit einem Zoom in ein Gemälde (und das Gemälde daneben zeigt bereits sein Ende, was aber der Zuschauer ja noch nicht weiß) und gleich darauf tritt ein allwissender Erzähler ins Bild, der den gesamten Film über präsent bleiben und stets betonen wird, dass wir uns in der Fiktion befinden. Auch sonst wird immer wieder postmodern eine zusätzliche Ebene der Künstlichkeit eingebracht, wenn etwa ein Gangsterboss in seinem Hauptquartier eine Bühne errichtet hat oder Harloff ausgerechnet (und, für den eigentlichen Plot irrelevant) am Stendhal-Syndrom leidet. Auch, dass der Anfang der Handlung eine kaum verkennbare Anspielung auf „Spiel mir das Lied vom Tod“ ist, erinnert gleich daran, dass das Gezeigte eine Kunstwelt ist. Harloffs Plan verweist zudem auf die antike Tragödie, welche ja die Grundlage der westlichen Erzählkunst bildete. Eine wichtige Rolle spielt auch Truffauts Film „Jules et Jim“, der eines der wichtigen Werke der Nouvelle Vague ist, also ebenfalls mit Filmgeschichte beladen.
Die, mit klassischer Musik untermalte, oder zu Ölgemälden erstarrende Gewaltdarstellung mit der absurd hohen Zahl von fast 50 Toten hebt sich ebenfalls bewusst und deutlich von jedem realen Tötungsakt ab. Hier wird nicht die Grausamkeit des Menschen angeklagt, hier wird das Töten als Fiktion, als bloßes Zeichen ohne Konsequenzen für die Realität herausgestellt – und entsprechend ironisch am Ende noch einmal der Toten gedacht. Wenn man den Film mit irgendetwas vergleichen will, dann allerhöchstens mit „Rubber“ – dem bizarren Experimentalwerk über einen psychokinetischen Autoreifen.
… ist gleich Highlight-„Tatort“
Wenn man etwas an diesem „Tatort“ aussetzen will, dann das, dass dieses Meisterstück Teil einer Serie sein muss und nicht als eigenständiger Film seinem Land Ehre macht. Ernsthaft: „Im Schmerz geboren“ gehört mit englischen Untertiteln versehen auf internationale Festivals, dass die Leute sehen, dass auch hierzulande künstlerische Qualität möglich ist.
Mich frustriert der Gedanke, dass der Film, sollte er auf DVD erscheinen, sich stets unter das Label einer Reihe wird ducken müssen, die mit seiner Spielfreude nichts zu tun hat.
Habe ich nun den Glauben in den „Tatort“ wiedergefunden? – Natürlich nicht!
Dazu wirkt auch mit, dass Regisseur Florian Schwarz auch „Weil sie böse sind“ (2010), das andere große, von mir gesichtete Highlight der Reihe inszenierte und Autor Michael Proehl bereits an den besseren, mit Henning Mankell geschriebenen Borowski-„Tatort“-Folgen mitwirkte. Wir haben es also wohl weniger mit einem Aufwärtstrend in der Reihe, als einigen wenigen überaus talentierten Menschen zu tun.
Aber grämen wir uns weniger darüber, als uns daran zu erfreuen, dass sie in dieser Reihe untergekommen sind und so ein Meisterwerk produzierten, wie es im deutschen Kino zugunsten Geschlechterklischeekomödien keinen Platz hat.