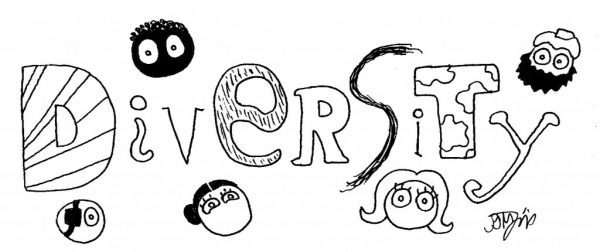Diversity done right & wrong (2/2)
Im ersten Teil dieses Artikels hatte ich ja bereits meine grundlegende Einstellung zum momentanen Streit um Diversität in den Medien mitgeteilt. Zur Wiederholung: Jeder Fall muss für sich betrachtet werden, Vorurteile über Andersdenkende helfen dabei nie. Dann kündigte ich einen Richtungswechsel an, in dem ich ein meiner Meinung positives Beispiel nennen wollte – und das, lieber Leser, hast du jetzt vor dir.
Fördern statt fordern
Ich spreche von Disneys TV-Serie „Once Upon a Time“.
Schwerlich ein Meisterwerk in der Klasse von „Breaking Bad“ oder „Game of Thrones“, aber eine kleine Perle, die noch dazu zeigt, wie wunderbar und zwanglos Diversität funktionieren kann.
Es handelt von einer kleinen Stadt, in welcher verschiedene Märchenfiguren leben. Anfangs noch ohne Erinnerung an ihre frühere Märchenidentität, inzwischen aber mit reichlich Dimensionsreisen zu anderen fiktiven Gestalten, wie Dr. Frankenstein oder dem Zauberer von Oz. Ich gebe zu, dass der Einstieg recht schwer fällt, da der Fokus anfangs auf den sehr uninteressanten originären Hauptfiguren liegt, doch auch da schon ist die komplexe Erzählweise zu loben, in der pro Folge zwei Handlungsstränge auf verschiedenen Zeitebenen betrieben werden. Später versucht man zudem, weniger Märchen, als vielmehr Disney-Mega-Crossover zu sein und bringt munter Arielle die Meerjungfrau, Peter Pan, Mulan und Schneekönigin Elsa hinein, zudem wendet man sich statt der lahmen Helden den unterhaltsamen Bösewichten Regina (Schneewittchens böser Stiefmutter) und Rumpelstilzchen (hier kein Kobold, sondern ein intrigierender Mephisto) zu. So gelangen zum Teil wunderbare Verknüpfungen, wie dass Rumpelstilzchen etwa auch das Biest ist, in welches sich die schöne Belle verliebt.
Anfangs protestierte der Mediävist in mir, dass in der mittelalterlichen Märchenwelt alle Hautfarben präsent waren und die Geschlechter gleichberechtigt agierten (unter den sieben Zwergen etwa befindet sich ein schwarzer und ein asiatischer Zwerg) und man eine recht moderne Einstellung zum Wert des Lebens pflegt. Aber dann ging mir auf, dass dies ja auch schlicht nicht das europäische Mittelalter sein sollte. Dies war eine Welt, in welcher die Herzkönigin aus dem Wunderland (mit dem Special Move, Leuten das Herz heraus zu reißen) sich mit Aladdins Feind Jaffar verbündete, während Robin Hood mit der Werwölfin Rotkäppchen im Untergrund lebte. Und in dieser Welt konnte man einigen Spaß haben.
Natürlich gibt es disneytypischen Schnulz, so dass die Liebe die größte aller Zauberkräfte ist und regelmäßig als deus ex machina auftritt, aber damit lässt sich leben.
Bevor jemand anmerkt, dass die Diversität auf Nebendarsteller bezieht, während die Hauptfiguren durch die Bank weiß sind, sage ich gleich selbst, dass es mir hier vor allem um Geschlechterzeug geht: Denn fast alle Hauptfiguren sind weiblich und auch die männlichen Charaktere werden meist durch Frauen motiviert. Jede der Heldinnen wie Schurkinnen hat ihre eigenen Fähigkeiten, alle sind sie aktiv Handelnde. Und hier zeigt sich ein gewaltiger Unterschied zu so vielen betont feministischen Erzählungen: Wenn hier etwa Schneewittchen ihren Prinzen retten muss, wird es als Selbstverständlichkeit dargestellt und auch ihm nicht als Makel angeheftet. Frauen sind überrepräsentiert, aber gleichgestellt. Der Prinz ist kein Versager, weil er weiblicher Hilfe bedarf, Schneewittchen eine Heldin, weil sie hilft. Nicht, weil sie hilft obwohl sie eine Frau ist.
Geschlechterkrieger verbrennen die Erde
Die Verachtung für den Mann, die so oft die Grundlage als stark gedachter Frauenfiguren ist, fehlt hier völlig und insofern gibt es auch kein Problem für den männlichen Zuschauer. Oft werden Heldinnen gerade in einer Form etabliert, dass sie Männer übertreffen und demütigen und dies selbst noch direkt als weibliche Überlegenheit deklarieren. Die Werbung kreischt, wie sehr diese Agentin/Piratin/Revolverfrau den Männern einheizen oder zeigen würde, wo der Hammer hängt – und so wird aktiv Sexismus betrieben und der männliche Zuschauer natürlich fern gehalten.
All das tut „Once Upon a Time“ nicht, sondern lässt seine Heldinnen sich in der Praxis bewähren. Das ist alles nicht neu. So etwas gab es schon lange – nur leider droht es heutzutage, wo Diversitätsfragen stärker erörtert werden, vergessen zu werden.
„Ally McBeal“ und „Buffy – Im Bann der Dämonen“ zählten zu meinen Lieblingsserien und habe begeistert die Abenteuer der „Desperate Housewives“ verfolgt (wobei alle drei übrigens mehr Staffeln hatten, als gut für sie war) und nie den Schatten eines Problems damit gehabt, dass die Hauptcharaktere ein anderes Geschlecht hatten, als ich. Ähnlich in der, diesbezüglich ja gerade besonders umstrittene Welt der Videospiele: Mein Lieblingsshooter war lange Zeit „Perfect Dark“, bei „Super Mario Kart“ fahre ich so gut wie immer mit Prinzessin Peach und Lara Croft zählt zu den bekanntesten Videospielfiguren überhaupt.
Das alles geschah zu Zeiten, als der Frauenanteil unter Videospielern noch wesentlich geringer war als heute, dennoch hatte niemand Schwierigkeiten mit der Identifikation. Joanna Darks, von meinen unterschiedliche Genitalien haben mich ebenso wenig gestört, wie Super Marios Handwerkszunft und ich glaube, die weiblichen Spieler hatten auch keine größere Distanz zu Simon Belmont oder einem der vielen gritty space marines diverser Shooter.
Doch dann kamen vermeintliche Experten und beschlossen, männliche Spieler (damals eben die logische Zielgruppe) würden sich nur mit männlichen Figuren identifizieren und später vermeintliche Kämpfer für Gleichberechtigung und erklärten den, von Herstellern vermuteten Sexismus – wie Angela Night hier ausführt – zur Tatsache über die Spieler. Vermutlich die gleichen Leute, die sicher waren, Superhelden müssten nervige kindliche Begleiter haben, da sich die Leser sicher lieber mit dem lahmen Robin als dem coolen Batman identifizieren würden.
Dass sich vorher jeder selbstverständlich mit jedem Geschlecht anfreundete, wurde auf einmal problematisiert und das (nebenbei bemerkt, meist recht überzogen behauptete) Fehlen weiblicher Hauptfiguren zu einem Hassverbrechen hochstilisiert. Wer früher eine weibliche Hauptfigur schuf, musste vielleicht einen konservativen Vorgesetzten davon überzeugen, heute weiß er, dass er sich damit mitten in einen laufenden Bürgerkrieg begibt.
Ja, auch ich bin für Diversität. Die großen Mainstreamhelden der Fiktion sind zu einer gewaltigen Überzahl weiß und männlich und es ist schon und förderungswürdig, da mehr Vielfalt einzubringen. Nur ist es eben keine Pflicht.
Wer die Geschichte seines weißen Helden erzählt, verdrängt damit keine schwarze Heldin oder spricht sich gegen eine solche aus. Er ist schöpferisch, kreativ tätig. Was etwas Gutes ist!
Wer etwas ablehnt, weil es nur von straight white guys handelt oder betrieben wird, ist nicht offen, sondern zeigt damit erst jene Engstirnigkeit, die Marktstrategen uns eigentlich zu unrecht unterstellen. So stärkt man die Unterschiede, statt der Gemeinsamkeit, macht ein Problem aus Andersartigkeit, wo vorher keines war.
Mit Entsetzen höre ich etwa, wie Tolkien zuweilen als gestört oder creepy bezeichnet wird, weil seine, an den nordischen Mythen orientierte Fantasy kaum weibliche Figuren kennt. Da ist dann der berechtigte Wunsch nach Vielfalt in bösartiges, abfälliges Anspruchsdenken umgeschlagen. Und das führt selten zu etwas Gutem.
Solche eifrigen Kämpfer sagen mir zuweilen, das sei momentan zwar eine schwere Zeit, aber wenn erst der Sieg errungen sei, lebten wir alle in einer bessern Welt der absoluten Gleichberechtigung und um diese zu erreichen müsse man halt mal hinnehmen, dass ein paar Leute gemobbt werden und Wahrheiten, die nicht ins Konzept passen, zugunsten passender Unwahrheiten zurückstecken müssen. Der Zweck heilige schließlich die Mittel und der Sieg sei nah.
Ich glaube das nicht.
Ich sehe den ganzen traurigen Geschlechterkrieg – ob in den Unterhaltungsmedien oder überhaupt – nicht wie den Kampf zwischen Achsenmächten und Alliierten, aus denen nur ein Sieger und ein System hervorgehen kann, sondern wie den Nahostkonflikt: einen aussichtslosen ewigen Kampf, der nicht durch Sieg, sondern nur durch Kooperation beendet werden kann.
Und Kooperation erreicht man besser durch Entspannung, denn Polemik. Solange wir dem anderen gleich unterstellen, er gehöre der totalitären Gruppe X an, oder unsere Helden dadurch feiern, die der anderen zu erniedrigen, werden sich die Leute kaum zusammenfinden.
Beispiele wie „Once Upon a Time“ zeigen, dass es auch anders geht.