DER SPIEGEL und die Fernsehkrimis
Der aktuelle SPIEGEL (Nr. 28/2013) verwendet einen dreiseitigen Artikel seiner Autoren Alexander Kühn und Marcel Rosenbach auf ein Thema, zu dem ich auch schon länger mal etwas sagen wollte, aber irgendwie nicht genug zu sagen hatte.
Im zentralen Punkt sind wir uns einig: Das deutsche Fernsehen erstickt derzeit in Krimis. Ich lache immer wieder gern über die Fernsehzeitschrift TV HÖREN UND SEHEN, welche tatsächlich einen „Krimi-Finder“ hat und alle Krimis im Programm mit einem Logo kennzeichnet – etwa so notwendig wie ein „Penis-Finder“ im Chatroulette. Doch schon der Titel des Artikels deutet auf unterschiedliche Wahrnehmung hin: „Das Grauen am Abend“.
Entsprechend beginnt der Text:
“Der deutsche Fernsehzuschauer muss ein Scheusal sein. Sonntag für Sonntag fordert er ein Menschenopfer: erschossen, stranguliert, ertränkt, vergiftet, die Treppe hinuntergeschubst, in den Selbstmord getrieben, erfroren oder Verbrannt. Vor einigen Wochen, im ‚Tatort’ aus Frankfurt am Main, wurden dem Mordopfer sogar die Zehennägel ausgerissen.“
Das mag alles richtig sein, zeichnet aber ein etwas irreführendes Bild des deutschen TV-Krimis als grausiges Schlachthaus, in dem sich die Blutigkeiten nur so überbieten. So wird auch gleich ein Psychiater befragt, der erzählen darf, wieso Menschen sich extremem Nervenkitzel aussetzen, aber nicht sagt, wann das letzte Mal ein „Tatort“ einen solchen bot.
Danach werden auch die Heimat- und „Schmunzelkrimis“ (ein furchtbares Wort – aber ich beharre darauf, dass der Urvater „Mord mit Aussicht“ tatsächlich gut ist) behandelt und die Monokultur beklagt, aber der schräge Eindruck des Anfangs bleibt. Als Grund für die Beliebtheit von Krimis wird angegeben, dass diese ein Stück heiler Welt bilden und in unserer überkomplexen Realität etwas Gerechtigkeit und Orientierung bieten. Sicher nicht falsch: über Erzählungen von Verbrechen verständigt man sich über die Ordnung.
Doch als positives Gegenbeispiel im Krimieinerlei wird dann der kommende „Polizeiruf 110“ namens „Der Tod macht Engel aus uns allen“ genannt, da dort am Ende keine Problemlösung bestünde und so endlich einmal gegen die Konventionen verstoßen werde.
Ich kenne den Film nicht, ich wage nicht, ihn zu beurteilen, aber die Darstellung des deutschen Krimis als Horrorshow, in welchem am Ende eine sauber-heile Welt wiederhergestellt wird, geht vollkommen an dem vorbei, wie ich ihn wahrnahm.
Natürlich gibt es diese biederen Heimatkrimis, aber in denen hält sich das Grauen zurück: meist ist das Opfer von Anfang an tot, dramatische Szenen der Trauer oder des Sterbens gibt es nicht und nun wird nur noch der Fall aufgerollt. Wenn es schmerzhafter zugeht, dann aber meist gerade mit einer flachen und substanzlosen Art von Gesellschaftskritik, die den Autoren (die ja beim Öffentlich-rechtlichen Fernsehen arbeiten und definitiv Teil des Systems sind) vermutlich nicht am Herzen liegt. Wenn die Kölner „Tatort“-Kommissare im Müll nach der verlorenen Tatwaffe suchen, müssen sie kurz darüber sprechen, wie viel Abfall unsere Wohlstandsgesellschaft doch produziert und wenn Ulrike Folkerts in Ludwigshafen ermittelt, weiß man schon, dass soziale Ungerechtigkeit, Giftstoffe in Lebensmitteln oder Geschäfte mit Diktaturen im schwach beleuchteten Film mehr Zeit einnehmen, als die Lösung des Falls. Entsprechend gern wird auch am Ende betont, dass jetzt zwar ein Mörder hinter Gitter ist, die wahren Schuldigen aber ja Teil des Systems wären.
Das ist nicht tiefgründig, das ist nicht aufklärerisch, das ist Routine.
Nun will ich nicht das allgegenwärtige Loblied der Überlegenheit der neuen US-Serien singen (zu sehr wurmt mich, dass ich tatsächlich gerade Fan der meist zitierten Shows „Breaking Bad“ und „Homeland“ bin), aber vergleichen wir diese mit den hiesigen, fällt doch etwas auf:
Denn es stellt sich die Frage, was genau der Reiz ist, den unsere Krimis bieten wollen. Ich bin kein sonderlicher „CSI“-Fan, aber ich verstehe, wie sich Leute von der überstylten Inszenierung, den technischen Spielereien und den teils extremen Verbrechen faszinieren lassen. Auch leichtere Serien um kauzige Ermittler und exzentrische Genies haben einen klaren Reiz. Doch worum geht es in unseren Krimis?
Tatsächlich um trockene Ermittlungsarbeit. Leute werden befragt, Akten gewälzt und die gleichen Leute noch mal befragt. Weder glänzt irgendeiner unserer TV-Kommissare durch besondere geistige Fähigkeiten, noch sind die Fälle so ausgefallen, dass sie an sich Rätsel aufgäben. Stattdessen zählen Durchschnittstypen meist viel zu viele Namen auf, als dass man den Überblick behielte und irgendwann ist ein lokales Wahrzeichen im Hintergrund zu sehen. Ab und zu mal eine unspektakuläre Verfolgungsjagd oder eine relativ kleine Schießerei, aber es ist selten, dass die Helden mal selbst in Gefahr geraten. Vielleicht ist es noch immer die Angst vor den Folgen vergangener Größenfantasien, welche die deutsche Populärkultur in die Mittelmäßigkeit fliehen lassen. Bloß keine Idole erschaffen, zu undemokratisch der Beigeschmack des großen Einzelnen.
Der Fairness halber sei angemerkt, dass Kühn und Rosenbach auch diese Routine anmerken, nachdem die Filme aber eingangs als bluttriefendes Horrorkabinett dargestellt wurden, wirkt der Vorwurf der Eintönigkeit doch etwas widersprüchlich. Weil Popularität bekanntlich verdächtig ist, werden die erfolgreichen „Tatort“-Helden aus Münster noch schnell abfällig als „Blödelduo“ bezeichnet und ignoriert, dass diese, bei denen der Krimianteil praktisch nur noch Alibi ist, um Figurenkomik zu inszenieren, ein guter Weg aus dem Einerlei wäre. Denn da hat man tatsächlich mal einprägsame und kantige Charaktere geschaffen, die nicht die Verkörperungen sozialen Bewusstseins, sondern interessante Figuren sind. Die Krimianteile sind der Tribut, den die Autoren dafür zahlen müssen, da alles seine Ordnung und sein Genre haben muss.
Was ich beklage, ist vor allem das Fehlen echter Emotion.
Wann hat man das letzte Mal wirklich etwas bei einem „Tatort“ empfunden? Wann hat man den Täter wirklich gefürchtet oder verabscheut? Wann hat man wirklich bei den Ermittlungen mit überlegt, was abgelaufen sein könnte, anstatt einfach auf die Aussage zu warten, die den Täter über sein Motiv enthüllt?
Dazu muss man aber weg von der Uniformität, von dem Kommissar als vertrautem Begleiter in blassen Fällen. Als der „Tatort“ seinen Ermittler Cenk fallen und vom rechten Weg abkommen ließ, war es eine katastrophale Fehlentscheidung, weil man damit seinen einzigen türkischen Kommissar diskreditierte, aber an sich eine gute Idee und ein Schritt zur moralischen Ambivalenz, die anspruchsvolle Erzählungen auszeichnet. Als man mit „Willkommen in Hamburg“ beschloss, es mal mit mehr Action zu versuchen, war es ebenfalls eine gute Idee, die nur durch die Anpassung an Til Schweiger versaut wurde. Und betrachtet man die tatsächlichen Juwelen, die ab und zu produziert werden (die „Tatort“-Folge „Weil sie böse sind“ oder der „Polizeiruf 110“ „Denn sie wissen nicht, was sie tun“) fällt auf, dass diese zumeist vom bekannten Schema abweichen. Da spielt der Kommissar kaum eine Rolle, oder es zählen emotionale Konflikte, statt wiederholter Befragungen.
Dieser Artikel ist kein Manifest und nicht einmal allzu stringent geschrieben, sondern eher eine vage Gedankensammlung, über den deutschen Krimi und besagten SPIEGEl-Artikel über ihn. Dennoch hoffe ich, etwas mein Problem mit ersterem aufgezeigt zu haben.
(Dirk M. Jürgens)

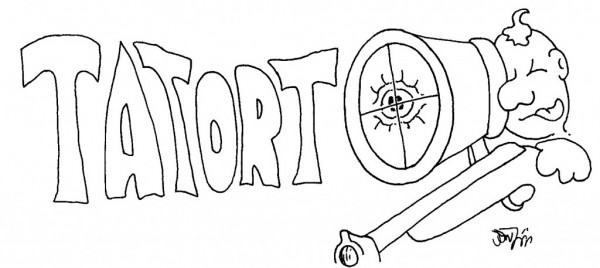





9. Juli 2013 @ 18:57
Erinnert mich mal wieder daran: http://www.youtube.com/watch?v=9QENcN-srE0
10. Juli 2013 @ 11:31
Oja, das kannte ich, das ist wirklich enorm treffend.
Und traurig, dass der darin mit einer Schallplatte begangene Mord tatsächlich ausgefallener ist, als die meisten in den echten Filmen.
29. September 2013 @ 16:48
Habe ich nur wegen William Petersen geguckt. Das Charisma von dem ist überwältigend; besonders mit der Stimme von Hubertus Bengsch. Als der ausstieg, war da kein Reiz mehr, das zu sehen.